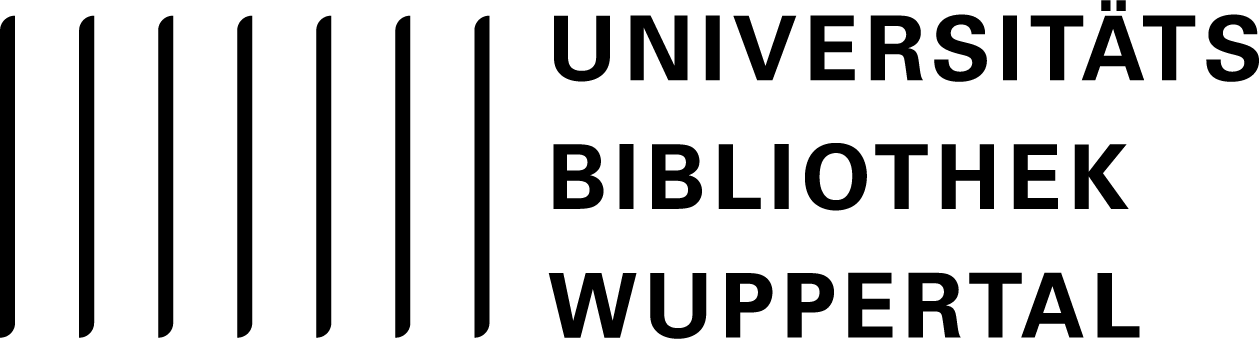Titelaufnahme
- TitelHochattraktiv oder nur nicht unattraktiv: was zählt bei der Partnerwahl? : Vermeidung von Unattraktivität - ein negatives Attraktivitätskonzept? / Vorgelegt von Kerstin Cyrus
- Verfasser
- Erschienen
- HochschulschriftWuppertal, Univ., Diss., 2009
- SpracheDeutsch
- DokumenttypDissertation
- URN
- Das Dokument ist frei verfügbar
- Social MediaShare
- Nachweis
- Archiv
- IIIF
Deutsch
Dass der physischen Attraktivität eine hohe Bedeutung beigemessen wird und Menschen viel Zeit und Mühe darin investieren, ihr äußeres Erscheinungsbild aufzuwerten, ist epochen- und kulturübergreifend zu beobachten. Evolutionspsychologische Forschungsarbeiten widmen sich vor allem der Fragestellung, welche Rolle physische Attraktivität im Partnerwahlkontext spielt. Der Versuch der Evolutionspsychologie, Antworten auf die Frage zu finden, was physische Attraktivität ausmacht und welche spezifischen Funktionalitäten der Ausbildung und der Präferenz bestimmter physischer Merkmale zugrunde liegen, hat eine lange Forschungstradition. Die bislang gängige Sichtweise der ‚good genes' - Hypothese, dass attraktive Merkmale ‚mate quality' signalisieren, und dass Präferenzen und aufsuchendes Verhalten hinsichtlich dieser Merkmale entstanden sind, da diese den eigenen Reproduktionserfolg erhöht haben (Hamilton & Zuk, 1982; Thornhill & Gangstad, 1993), wirft jedoch einige Fragen auf. Ist das Streben nach hochattraktiven physischen Merkmalen bei potentiellen Partnern aus evolutionspsychologischer Sicht tatsächlich eine erfolgreiche Strategie? Konnten sich diejenigen, die eine ‚go for the best' - Strategie verfolgten, erfolgreicher fortpflanzen? Unter dem Aspekt, dass dies die Auswahl bei der Partnerwahl erheblich einschränken würde, da nur wenige potentielle Partner ein sehr hohes Attraktivitätsniveau aufweisen und die Erreichung dieser erfordern würde, selbst einen hohen ‚mate value' zu präsentieren, scheint eine solche Sichtweise nicht unproblematisch. Einige Forschungsarbeiten weisen in eine andere Richtung: Der Vermeidung unattraktiver Merkmale im potentiellen Partner käme demnach eine höhere Relevanz zuteil (Li, Bailey, Kenrick und Linsenmeier, 2002; Grammer, Fink, Juette, Ronzal & Thornhill, 2002; Zebrowitz, Fellous, Mignault & Andreoletti, 2003; Zebrowitz & Rhodes, 2004). Unter einem Kosten-Nutzen-Aspekt betrachtet, welcher nach der Error-Management-Theorie (Haselton & Buss, 2000) bei Entscheidungen unter Unsicherheitsbedingungen richtungweisend ist, scheint der kostenträchtigste "Fehler" zu sein, einen Partner mit schlechter genetischer Ausstattung zu wählen, indem Merkmale, die diese signalisieren könnten, nicht identifiziert werden. Einen durchschnittlich attraktiven Partner einem hochattraktiven Partner vorzuziehen, da Merkmale, die auf besonders hochwertige genetische Ausstattung hinweisen könnten, nicht erkannt würden, wäre hingegen weniger kostenträchtig. In den nachfolgenden vier Untersuchungen wird die Annahme geprüft, ob ein psycho-logischer Partnerwahlmechanismus, der die physische Attraktivität als ein Kriterium erfasst, auf einer "Unattraktivitäts-Vermeidens-Tendenz" basiert. Unter Anwendung einer Prototy-penanalyse wurden in Studie 1 und 2 gegengeschlechtliche, physische Merkmale von besonders hoher und besonders niedriger Attraktivität erfasst, um im Anschluss zu prüfen, wie die semantische Struktur der Konzepte "Hässlichkeit" und "Schönheit" in Bezug auf potentielle Partner beschaffen ist. Wenn es wichtiger wäre, unattraktive Partner zu meiden, als hochattraktive Partner aufzusuchen, sollten Personen folglich eine genauere Vorstellung davon haben, was Unattraktivität beim Gegengeschlecht ausmacht. In Studie 1 wurden 266 Versuchpersonen instruiert, im Zeitrahmen von vier Minuten alle optischen Merkmale zu notieren, welche sie bei einer gegengeschlechtlichen Person als "schön" (vs. "hässlich") bezeichnen würden. Es zeigte sich, dass sowohl bei der Generierung von Merkmalen für das Konzept "Schönheit", als auch für das Konzept "Hässlichkeit" kein Merkmal von allen Personen übereinstimmend zur Beschreibung des entsprechenden Konstruktes genannt wurde. Es gab also weder notwendige Merkmale zur Beschreibung des Konstruktes, wie man dies bei einer klassischen Definition von Begriffen erwarten würde, noch gab es hinreichende Merkmale, welche zur Beschreibung der Kategorie ausreichen würden (vgl. Medin, 1989). Dennoch stimmten die Versuchsteilnehmer bei einigen Merkmalen stärker überein als bei anderen. Die Inhalte variieren somit nicht vollkommen interindividuell, kongruent zu einer prototypischen Struktur einer Kategorie (Hassebrauck, 1997). Diese Übereinstimmung zeigte sich geschlechtsunabhängig deutlicher für das Konstrukt "Hässlichkeit" als für das Konstrukt "Schönheit". In Studie 2 wurden die empirisch gewonnen Merkmale, welche zuvor von mehr als einer Person genannt wurden, hinsichtlich ihrer Typikalität für das jeweilige Konstrukt bewertet. 188 Partizipanten sollten die Merkmale auf einer 7-stufigen Skala bezüglich der Frage beurteilen, ob es sich bei dem Begriff um ein Merkmal handelt, welches eine gegengeschlechtliche Person, die schlecht (vs. gut) aussieht, sehr stark kennzeichnet, oder ob es ein mittelmäßiger Indikator für eine schlecht (vs. gut) aussehende gegengeschlechtliche Person ist, oder ob dieses Merkmal eine solche Person gar nicht kennzeichnet. Je klarer die prototypische Struktur einer Kategorie, desto deutlicher sollten Urteiler eine Übereinstimmung bezüglich der Zentralität der Merkmale zeigen, sie sollten sich somit relativ einig sein, welche Merkmale eher zentral, und welche eher peripher für ein entsprechendes Konstrukt sind. Ausgehend von der ursprünglichen Annahme, es sei wichtiger, unattraktive Merkmale beim Gegengeschlecht zu identifizieren als hochattraktive, sollte ein deutlicherer Prototyp für "Hässlichkeit" als für "Schönheit" existieren. Die Hypothese lautete somit, dass Männer und Frauen eine höhere Beurteilerübereinstimmung über die Zentralität der Merkmale des Konstruktes "Hässlichkeit" als "Schönheit" bei der gegengeschlechtlichen Einschätzung zeigen. Als Maß zur Quantifizierung der Beurteilerübereinstimmung wurde der adjustierte, einfaktorielle Intraklassenkorrelationskoeffizient (ICCeinfakt,just) mit einem zufälligen Rater - Faktor (random) nach Winer (1971) berechnet. Die Ergebnisse bestätigten die Hypothese. Es zeigte sich eine stärkere Übereinstimmung hinsichtlich der Vorstellung darüber, was einen Partner des Gegengeschlechts kennzeichnet, der besonders schlecht aussieht. Der Konsens darüber, was einen gegengeschlechtlichen potentiellen Partner kennzeichnet, der besonders gut aussieht, war geringer. Die Differenzierungen zwischen den beiden Konzepten waren bei Männern höher als bei Frauen. Wenn es wichtiger wäre, unattraktive potentielle Partner zu meiden, als hochattraktive aufzusuchen, sollte man erstere auch besser von durchschnittlich attraktiven differenzieren können. Studie 3 und 4 widmeten sich der Frage, ob es besser gelingt, unattraktive Stimuli von mittelmäßig attraktiven schnell und treffsicher zu unterscheiden, als schöne von mittelmäßig attraktiven Stimuli. Wenn ja, wie wirkt sich dies auf die Informationsverarbeitung aus? Werden unattraktive Stimuli besser wiedererkannt, oder werden sie gar schneller entdeckt? Um die Fragestellungen experimentell zu überprüfen, wurden insgesamt 321 Farbporträts von Männern und Frauen zwischen 20 und 30 Jahren angefertigt und mit Adobe Photoshop 6.0 hinsichtlich Kontrast, Helligkeit, Hintergrundfarbe und Augenhöhe standardisiert. Die Stimuli zeigten alle einen neutralen Gesichtsausdruck. In einer Voruntersuchung wurden die Gesichter auf einer 9-stufigen Skala hinsichtlich ihrer Attraktivität bewertet. In Studie 3 wurden auf dieser Grundlage die 24 attraktivsten, mittelattraktiven und unattraktivsten Stimuli ausgewählt. In einem Rekognitionstest wurde die Hypothese geprüft, dass die Diskriminationsleistung (d') bei unattraktiven Stimuli besser und schneller sei als bei Stimuli der beiden anderen Kategorien. In einem ersten Durchgang wurden insgesamt 48 Bilder (16 unattraktive, 16 mittelmäßig attraktive, 16 hochattraktive) randomisiert dargeboten. Die Präsentationsdauer im ersten Durchlauf betrug 3000 Millisekunden pro Foto. Das Ausblendintervall betrug 1000 Millisekunden, danach wurde das nächste Bild eingeblendet. Im Anschluss an die erste Präsentation erfolgte eine Distraktionsaufgabe. In dieser mussten die 116 Teilnehmer insgesamt 16 Fragen zu allgemeinen Wissensbereichen im ‚multiple choice' - Format beantworten. Im Anschluss folgte der zweite Teil der Untersuchung, die Wiedererkennungsaufgabe. Hierfür wurden pro Kategorie 8 Bilder ausgetauscht, somit wurden 8 alte und 8 neue Bilder pro Kategorie dargeboten. Die Versuchspersonen hatten nun die Aufgabe zu entscheiden, ob sie das im 2. Durchgang dargebotene Gesicht bereits im 1. Durchgang gesehen hatten oder nicht. Es wurden entweder gegengeschlechtliche oder gleichgeschlechtliche Stimuli präsentiert, eine unterschiedliche Diskriminationsleistung, bei welcher den Treffern die falschen Alarme in Rechnung gestellt werden, sollte sich nur im gegengeschlechtlichen Kontext zeigen. Wie vermutet, zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt des Messwiederholungsfaktors "Kategorie des Stimulus". Unattraktive Stimuli wurden sowohl häufiger als auch schneller richtig wiedererkannt als mittelmäßig attraktive oder hochattraktive. Allerdings zeigte sich dies, entgegen der vorherigen Annahme, nicht nur im gegengeschlechtlichen, sondern auch im gleichgeschlechtlichen Kontext. Studie 4 hatte zum Ziel, Informationsverarbeitungsprozesse in einer frühen Phase der Informationsverarbeitung, der Detektion von Reizen, aufzudecken. Der Versuchsaufbau dieses Experiments lehnte sich an die Originalstudie zum ‚face-in-the-crowd' - Effekt von Hansen und Hansen (1988) an. Es wurde vermutet, dass es in einer Menge von Gesichtern, in welcher ein diskrepantes Gesicht hinsichtlich des Attraktivitätsniveaus entdeckt werden soll, wichtiger sei, ein besonders unattraktives Gesicht schnell und treffsicher zu identifizieren, als ein mittelmäßig attraktives oder hochattraktives diskrepantes Gesicht. Unter evolutionstheoretischer Perspektive macht ein solcher Detektionsmechanismus die Vermeidung eines Partners mit niedrigem ‚mate value' wahrscheinlicher. Hierzu nahmen 112 Teilnehmer an einem mit der Software ‚Superlab' konstruierten Experiment teil, es wurden jeweils in einer 3 x 3 - Matrix neun unterschiedliche Gesichter auf einem 17' - Röhrenmonitor präsentiert. Die Probanden sollten die Menge der Bilder nach einem abweichenden Gesicht in Bezug auf das Attraktivitätsniveau absuchen. Es gab 108 Durchgänge, die Hälfte davon zeigte Mengen von Gesichtern mit Abweichler, die andere Hälfte Mengen von Gesichtern mit gleicher Valenz bezüglich des Attraktivitätsniveaus. Falls die Versuchsperson einen Abweichler identifizieren konnte, sollte sie dies durch Drücken einer bestimmten Taste bestätigen, falls nicht, sollte dies durch Drücken einer anderen Taste festgehalten werden. Die Stimuli wurden auf Grundlage des bereits vorliegenden Bildmaterials und den Bewertungen zuvor in die entsprechenden Kategorien eingeordnet. Es wurde wiederum vermutet, dass eine höhere Entdeckerquote unattraktiver Stimuli nur im gegengeschlechtlichen Kontext erzielt würde. Hypothesenkonform zeigte sich, dass unattraktive Abweichler tatsächlich häufiger entdeckt wurden, unabhängig der Valenz der Menge. Allerdings zeigte sich dieser Effekt sowohl im gegengeschlechtlichen als auch im gleichgeschlechtlichen Kontext. Insgesamt lässt sich resümieren, dass, unter Anwendung verschiedener Untersuchungsansätze, sich eine deutlich stärkere Repräsentation unattraktiver physischer Merkmale im Gedächtnis feststellen lässt. Dies legt, wie eingangs vermutet, eine "Unattraktivitäts-Vermeidens-Tendenz" entgegen einem "Attraktivitäts-Präferenz-Modell" nahe. Es scheint demnach von höherer Priorität zu sein, Personen mit unattraktiven Merkmalen zu meiden, als solche mit hochattraktiven Merkmalen aufzusuchen. Dies spiegelt sich darin wider, dass das Konzept von gegengeschlechtlicher "Hässlichkeit" semantisch eindeutiger und übereinstimmender zu sein scheint, als das Konstrukt gegengeschlechtlicher "Schönheit". Zudem werden Personen besser und schneller erinnert, wenn sie besonders unattraktiv sind, als wenn sie mittelmäßig attraktiv, oder hochattraktiv, sind. Weiterhin werden in Mengen von Gesichtern mit gleicher Valenz unattraktive Abweichler am häufigsten entdeckt, was auf einen psychologischen Mechanismus hindeutet, der schon in einer relativ frühen Phase die Informationsverarbeitung steuert. Entgegen der Sichtweise, welche die Bedeutsamkeit hoher Attraktivität bei der Partnerwahl propagiert, weisen die vorliegenden Befunde nicht auf eine solche Relevanz maximal attraktiver physischer Merkmale. Allerdings konnten keine geschlechtsgebundenen Effekte festgestellt werden. Dies könnte darauf hindeuten, dass es sich bei einem psychologischen Mechanismus, der in Richtung Unattraktivitätsvermeidung steuert, um einen bereichsübergreifenden Mechanismus handelt, der sich nicht nur im Partnerwahlkontext zeigt. Weitere Untersuchungen hierzu sollten Annahmen in diese Richtung prüfen.
English
Undoubtedly, humans have an obsessive preoccupation with beauty and attractiveness, they spent plenty of time and money according to increase their physical appearance. Therefore, physical attractiveness is a field of research with a long tradition, particularly in mate choice context. Evolutionary psychologists emphasize that physical attractiveness provides honest cues to health and mate value. Even though there are highly variable beauty standards between and within societies, mate preferences lead to a set of anticipations for universal beauty standards that are not culturally bound. A main rationale for evolutionary psychologist has been to find out what are the physical markers of attractiveness and why they are important. The common view of good genes hypotheses is that the physical features that individuals find attractive were selected to act as signals of some underlying quality in its possessors, such as superior good health or good condition. Those individuals may possess fitter genes to pass on to offspring, which implicates a "go for the best" - strategy for potential partners that should have evolved. Evolutionary theorists suggest that fast and frugal algorithms operate in many everyday decision-making problems (Gigerenzer & Goldstein, 1996). Attractiveness-judgements of a potential partner influences reproductive success, a problem in mating context with high priority. Therefore the central question is how these psychological mechanisms operate to detect the right partner. Is 'go for the best' really a strategy which leads to optimal reproductive success? Error-management-theory (Haselton & Buss, 2000) delivers a perspective that leads to a different conclusion. In general, two types of errors are possible when judgments are made under uncertainty - false-positive (type I errors), also known as false alarms, and false-negative (type II errors), also known as misses. The false-positive error leads one to assume the existence of something where that thing does not exist, whereas a false-negative error leads one to miss the existence of something that does exist. The type of error that would bring about the worst consequences varies with the kind of situation. The consequences of error type I and type II are rarely symmetrical. When costs for survival or reproductive success are asymmetrical, the human mind should often be biased to make the less expensive error (Haselton, Nettle, & Andrews, 2005). Back to physical attractiveness: Would it be more costly to go for the most attractive feature to make a decision, and therefore risk overlooking a feature that could signal low mate-value? Or might it be more costly to focus on worst features, avoiding partners with low mate-value but, as a consequence, risk missing partners with maximal attractive features? Is it more important to avoid ugliness or to go for maximal beauty in a potential partner? In contrast to 'good genes' theorists, some researchers claim the higher importance of avoiding bad genes and unattractive features which could signal low genetic quality (Li, Bailey, Kenrick und Linsenmeier, 2002; Grammer, Fink, Juette, Ronzal & Thornhill, 2002; Zebrowitz, Fellous, Mignault & Andreoletti, 2003; Zebrowitz & Rhodes, 2004). The main interest of the following studies was finding support for an 'avoiding the worst feature' - mechanism. Such an algorithm would suggest that beauty perception is a negative concept, but not the reverse positive concept. Study 1 and 2 were based on prototype theory and examine the semantic structure of the two concepts "ugliness" and "beauty" regarding a potential mate. If it is more important to avoid ugliness than to seek prettiness, people should have a better definition of this concept, which would be reflected in a higher accordance in semantic attributes. The first Study pictures the production method, which arrogates a free listing of features of a given category. The assumption is that laypeople have a better understanding of what ugliness (vs. beauty) means in a mate, because the evolutionary importance of this concept should be much higher. 266 participants were instructed to spontaneously list all features that they would find ugly (vs. beautiful) in a person of the opposite sex, within a time limit of 4 minutes. No one feature was listed by all subjects, and neither necessary nor sufficient features could be identified, which reflects a prototypical definition of a category instead of a classical (cf. Medin, 1989). But even though there was not a total agreement about certain attributes, some features were mentioned commonly by many individuals. And, as hypothesized, there was more agreement regarding the features of an ugly person than of a beautiful opposite-sex person. In a second step, it was assumed that people should agree more about the centrality of features regarding ugliness than beauty in a potential partner. If a category possess' a prototypical structure, people should be able to indicate whether certain features of a category are typical or non typical, if they are central or peripheral. It was hypothesized that the inter-rater reliability is higher when judging centrality ratings of ugliness (vs. beauty). 188 participants were asked to rate on a scale of 1 to 7 each of the features listed by more than one person in Study 1 as being a very good indicator (= 7) or not a good indicator (= 1) (or anywhere in between) of a bad looking (vs. good looking) person of the opposite sex. As a measure of reliability, the intraclass correlation ICC (Winer, 1971) was computed. As predicted, there was higher consensus regarding the centrality of the features of ugliness (vs. beauty) when judging physical opposite-sex attributes. The differences between these two concepts were higher for male raters than for female raters. If it would be more important to avoid unattractive opposite-sex individuals than to seek for highly attractive ones, than greater attention and processing resources should be allocated to unattractive faces. To test this assumption, 321 color photographs of the faces of college-aged female and male adults were assembled and standardized with Adobe Photoshop 6.0 regarding contrast, brightness, background color and eye height as a reference point. In a pretest, the faces were rated for attractiveness using a 9-point Likert scale. In Study 3, respectively 24 photographs were categorized into three levels of attractiveness (most unattractive, moderate attractive, most attractive). 116 students participated in the recognition experiment. It was hypothesized that they would show a higher sensitivity index d' (Z(hit rate) - Z(false alarm rate) for unattractive faces with lower reaction times than for moderate or attractive faces, and this should prove true just in opposite-sex context. Conceptually, sensitivity refers to how hard or easy it is to discern between seen and unseen photographs. In the study phase, each face (16 unattractive, 16 moderate attractive, 16 highly attractive) was displayed for 3000 milliseconds, with a gating time of 1000 milliseconds. Participants saw either opposite-sex or same-sex photographs. A distraction exercise was inserted, with 16 multiple choice questions from 'trivial pursuit' game. Then participants performed a recognition test, in the instruction they were told that some of the faces that would appear on the screen had been presented previously but that also some of the pictures were new. Through pushing the right button they had to decide which one of these faces they had seen before. Respectively, half of the pictures of each category had been replaced through new ones. As predicted, unattractive stimuli were recognized more frequently and faster: d' was significantly higher and response latencies were significantly lower when the presented face was unattractive. But this was even the case for same-sex stimuli. The primary purpose of Study 4 was to investigate information processing during an earlier stage, the detection of a face in a crowed. Hansen and Hansen (1988) conducted an experiment with emotional relevant stimuli and found that angry faces had an information processing advantage over neutral and happy faces. Equivalent, unattractive faces should have an information processing advantage over moderate and highly attractive faces. The "face-in-the-crowd" - paradigm was used to test this assumption. 112 students participated as subjects in the experiment, which was programmed with "Superlab" software. The subjects were given the task of surveying crowds for the presence of a discrepant face regarding the attractiveness level. Each crowd consisted of nine full - face photographs with different individuals, they were arranged in a 3 x 3 matrix. On each of 108 trials, participants had to make a decision (absence or presence of a discrepant face) through pushing the right button. A discrepant face was present in one half of the trials and absent from the rest. It was hypothesized that an unattractive face in a discrepant crowd would be found more frequently (hits) than a moderate or a highly attractive face in a discrepant crowd. The findings supported the hypothesis from which the face-in-the-crowd effect was predicted: unattractive faces had an advantage in an early stage of information processing. But, as in Study 3, the same effect resulted when using same-sex stimuli. The data from these four Studies established support for an 'avoiding the worst feature' - mechanism, therefore beauty perception might be a negative, but not the reverse positive, concept. It seems to be more important to have a straight concept of what ugliness (vs. beauty) means, this was reflected in a higher accordance in semantic attributes. Also greater attention and processing resources seem to be allocated to unattractive faces (vs. moderate or highly attractive faces), unattractive stimuli were recognized more frequently and faster, and they were detected in discrepant crowds more efficiently. But these mechanism don't seem to operate in a domain-specific manner, the same findings resulted in same-sex context. Future research is essential to understand in which contexts an "avoid the worst feature" mechanism would work and to get deeper insights whether those features are already preattentively processed.
- Das PDF-Dokument wurde 332 mal heruntergeladen.