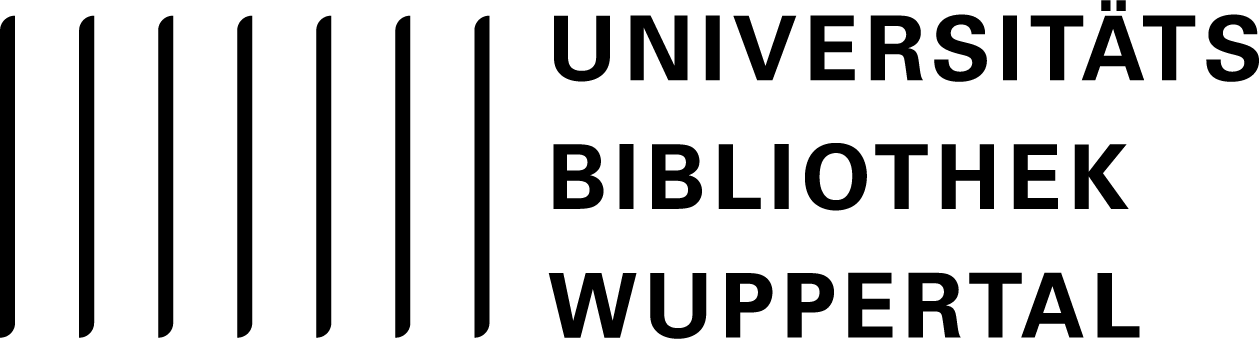Onboarding: Unterstützung betrieblicher Einarbeitungs- und Sozialisationsprozesse : empirische Studien zum Erleben neuer Anforderungssituationen (Modell, Diagnose und Handlungsempfehlungen) / vorgelegt von Giuseppina Scuzzarello-Eichmeier. Wuppertal, Januar 2020
Inhalt
- DANKSAGUNG
- GLIEDERUNG
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
- I ÜBERGREIFENDER ABSTRACT
- II EINLEITUNG
- 1 Relevanz der Themenstellung
- 3 Aufbau der Arbeit
- 2 Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit
- III THEORETISCHER HINTERGRUND
- 4 Onboarding-Bedarfe entlang des Employee Life Cicle in Organisationen der freien Wirtschaft
- 4.1 Terminologie, begriffliche Einordnung und Abgrenzung
- 4.2 Bedeutung für Leistungsfähigkeit und Mitarbeiterbindung
- 4.3 Erfahrungsmanagement: Von der Candidate Experience zur Onboarding Experience und darüber hinaus
- 4.3.1 Konzeptioneller Grundgedanke
- 4.3.2 Vom Net Promoter Score (NPS) zum Employee Net Promoter Score (eNPS)
- 4.4 Onboarding-Maßnahmen des Personalmanagements: Ein Überblick
- 4.5 Die interne Versetzung als Onboarding-Fall
- 5 Der Onboarding-Prozess als Gegenstand der Sozialisationsforschung
- 5.1 Terminologie
- 5.2 Theorien der Sozialisationsforschung
- 5.2.1 Theory of Organizational Socialization: Socialization Tactics
- 5.2.2 Sozial-kognitive Lerntheorie
- 5.2.3 Weiterführender Überblick: Social Identity Theory, Model of Social Capital und Interactionist Perspective
- 5.3 Theoretische Modelle zu Kernmerkmalen des Sozialisationsprozesses
- 5.3.1 Sozialisationsinhalte
- 5.3.2 Proaktive Sozialisationsstrategien
- 5.3.3 Sozialisation in Gruppen
- 5.3.4 Zeitliche Dynamik und Wendepunkte der Sozialisation
- 5.4 Moderatoren: Individuelle Unterschiede, soziale Unterstützung, Führung und der psychologische Vertrag
- 6 Subjektives Erleben neuer Anforderungssituationen: Perspektiven der psychologischen Forschung
- 6.1 Menschliche Motive als Ausgangspunkt und steuerndes Element
- 6.2 Emotionsforschung im Allgemeinen: Ein Überblick
- 6.3 Psychische Gesundheit in einer arbeitspsychologischen Ressourcenbetrachtung
- 6.3.1 Terminologie
- 6.3.2 Theoretische Modelle: Vom Überblick zu ausgewählten Job Strain und Job Demand Modellen (Job Strain-Control und Job Demands-Resources Model)
- 6.4 Bindungsforschung und affektives Commitment
- 7 Zwischenfazit: Neue Anforderungssituationen, Sozialisationseffekte und subjektives Erleben in der Gesamtbetrachtung
- IV. PRIMÄRFORSCHUNG I: QUALITATIVE INTERVIEWSTUDIE ZUM ERLEBEN DER FRÜHEN BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT
- 8 Fragestellung im Kontext der qualitativen Sozialforschung
- 8.1 Untersuchungsleitende Fragestellung und Begründung der Methoden
- 8.2 Methodologische Prinzipien
- 8.3 Gütekriterien
- 8.4 Sampling
- 9 Zusammenfassende Übersicht der qualitativen Interviewstudie
- 10 Kurzportrait des betrachteten Falles
- 11 Kontextanalyse
- 11.1 Historie und Ausgangslage
- 11.2 Beteiligte Stakeholder und deren Interessenslage
- 11.3 Strukturelle, prozessuale und rechtliche Rahmenbedingungen
- 11.4 Zielgruppenanalyse und -eingrenzung
- 12 Datenerhebung im Rahmen der qualitativen Interviewstudie
- 12.1 Akquisition der Interviewteilnehmer
- 12.2 Erhebungsmethode
- 12.2.1 Das problemzentrierte Interview
- 12.2.2 Critical Incident Technique
- 12.2.3 Kombination der Methoden
- 12.3 Konzeption des Interviewleitfadens als Erhebungsinstrument
- 12.4 Interviewumfeld
- 12.5 Interviewverlauf
- 12.6 Interviewdokumentation: Kurzfragebogen, Tonbandaufnahme und Postskriptum
- 13 Datenauswertung der qualitativen Interviewstudie
- 13.1 Transkriptum
- 13.2 Auswertungsmethode
- 13.3 Konkrete Vorgehensweise bei der Datenanalyse
- 14 Darstellung von Stichprobe und Auswertungsstruktur
- 14.1 Beschreibung der Stichprobe
- 14.2 Zusammenfassende Auswertungsübersicht und Fundstellenübersicht
- 15 Ergebnisdarstellung phasenspezifischer Phänomene
- 15.1 Antezedenzbedingungen kontinuierlicher Einwirkung
- 15.2 Mehrdimensionales Wirkungsmodell des Onboarding-Erlebens
- 15.2.1 Pre-Onboarding als Vorbereitungsphase
- 15.2.2 Die Newcomer-Situation
- 15.2.3 Onboarding-Dimensionen – aufgabenbezogen, sozial, organisationsbezogen und infrastrukturell
- 15.2.3.1 Aufgabenbezogene Dimension
- 15.2.3.2 Soziale Dimension
- 15.2.3.3 Organisationsbezogene Dimension
- 15.2.3.4 Infrastrukturelle Dimension
- 15.2.4 Post-Onboarding: Reflexionsphase subjektiver Zielerreichung
- 15.3 Zusammenfassende Darstellung des mehrdimensionalen Wirkungsmodells
- 16 Ergebnisdarstellung phasenübergreifender Phänomene
- 16.1 Mechanismen und Konstrukte subjektiven Erlebens
- 16.1.1 Einarbeitungs- und Sozialisationsstrategien
- 16.1.2 Zirkuläres Wirkungsmodell: Wohlbefinden, affektive Bindung und Arbeits- und Leistungsfähigkeit
- 16.2 Kritische Ereignistypen subjektiven Erlebens und integriertes Zeit-Ereignis-Modell: Relevance of Time, Moments of Truth
- 17 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung und Interpretation
- 18 Diskussion und Ausblick
- 18.1 Inhaltliche Diskussion der Ergebnisse
- 18.2 Reflexion methodischer Aspekte
- 18.3 Implikationen und Handlungsempfehlungen des Modells für die Praxis
- 18.4 Ausblick und weiterer Forschungsbedarf
- V. PRIMÄRFORSCHUNG II: FRAGEBOGENSTUDIE ZUM ERLEBEN NEUER ANFORDERUNGSSITUATIONEN (STANDORTBESTIMMUNG NEUER MITARBEITER/MITARBEITER IN EINER NEUEN FUNKTION)
- 20 Fragestellung und Begründung der Methoden
- 19 Zusammenfassende Darstellung der quantitativen Fragebogenstudie
- 20.1 Untersuchungsleitende Fragestellung und verwendetes Modell
- 20.2 Methodologische Prinzipien
- 20.3 Gütekriterien
- 20.4 Stichprobenumfangsplanung
- 21 Datenerhebung der quantitativen Fragebogenstudie
- 21.1 Von der Fragestellung zur Analysestrategie
- 21.2 Messverfahren
- 21.2.1 Realistic Job Preview
- 21.2.2 Feedback- und Orientierungsdefizite
- 21.2.3 Psychisches Erleben (EEB)
- 21.2.4 Soziales Erleben und soziale Unterstützung
- 21.2.5 Onboarding-bezogene Zufriedenheit
- 21.2.6 Affektives Commitment
- 21.2.7 Weiterempfehlungstendenzen (eNPS)
- 21.3 Fragebogenkonstruktion
- 21.3.1 Skalengestaltung
- 21.3.2 Verwendete Items und demografische Variablen
- 21.3.3 Befragungsinstrument (Fragebogen-Tool)
- 21.3.4 Pretest
- 21.4 Akquisition der Teilnehmer
- 22 Ergebnisdokumentation und Vorbereitung der Datenanalyse
- 22.1 Rohdatengewinnung und Datenaufbereitung
- 22.2 Stichprobe
- 22.3 Faktorenanalyse
- 22.4 Reliabilitätsanalyse und Skalenbildung
- 22.5 Datenexploration
- 23 Datenauswertung mittels Unterschiedsanalyse und Varianzanalyse
- 24 Ergebnisdarstellung der quantitativen Fragebogenstudie
- 24.1 Ergebnisse Fragestellung a): Vergleich betrachteter Variablen für die unterschiedlichen Anforderungssituationen
- 24.1.1 Unterschiede der Anforderungssituationen für betrachtete Prozess-Variablen
- 24.1.2 Unterschiede der Anforderungssituationen für betrachtete Output-Variablen
- 24.1.3 Detailanalysen von Nebenbedingungen als Robustheitstest
- 24.1.4 Fazit: Einflussfaktor Anforderungssituationen
- 24.2 Ergebnisse Fragestellung b): Quantifizieren und Bewerten der Leistungsfähigkeit mittels des Vierfelderschemas (VFS) im JSC- und im JSR-Modell
- 24.2.1 Vergleich der VFS im JSC- und im JSR-Modell der Gesamtstichprobe
- 24.2.2 Vergleich der VFS im JSC- und im JSR-Modell unterschiedlicher Anforderungssituationen
- 24.2.3 Fazit: Funktionszuordnung des VFS in der Onboarding-Phase je nach Modell (JSC und JSR)
- 24.3 Ergebnisse Fragestellung c): Interpretativer Vergleich im Kontext weiterer InputVariablen
- 24.3.1 Unterschiede und VFS – funktionsbedingt
- 24.3.2 Unterschiede und VFS – ressortbedingt/bereichsbedingt
- 24.3.3 Unterschiede und VFS – altersbedingt
- 24.3.4 Fazit: Zuordnung von Input-Variablen entsprechend ihrer Wirkung auf Prozessund Output-Variablen
- 24.4 Ergebnisse Fragestellung d): Interpretieren der Leistungsfähigkeit nach dem Vierfelderschema im Kontext von Prozess- und Output-Variablen
- 24.4.1 Verlaufscharakteristik der Prozess- und Output-Variablen im VFS
- 24.4.2 Vergleich der hemmenden Wirkung suboptimaler Risikostufen im VFS
- 24.4.3 Varianzanalyse der Prozess- und Output-Variablen innerhalb der Risikostufen der VFS
- 24.4.4 Fazit: Indikatorfunktion von VFS im JSC- und JSR-Modell für Prozess- und Output-Variablen
- 24.5 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung und Interpretation: Input-Prozess-Output-Modell zur Messung und handlungsleitenden Bewertung des subjektiven Erlebens von Mitarbeitern in neuen Anforderungssituationen
- 25 Diskussion und Ausblick
- 25.1 Inhaltliche Diskussion der Ergebnisse
- 25.2 Reflexion methodischer Aspekte
- 25.3 Implikationen und Handlungsempfehlungen für die Praxis
- 25.4 Ausblick und weiterer Forschungsbedarf
- LITERATURVERZEICHNIS